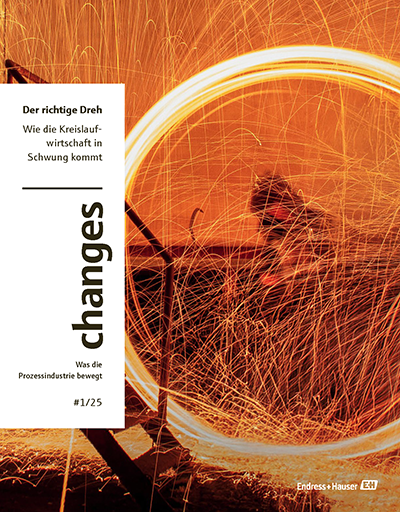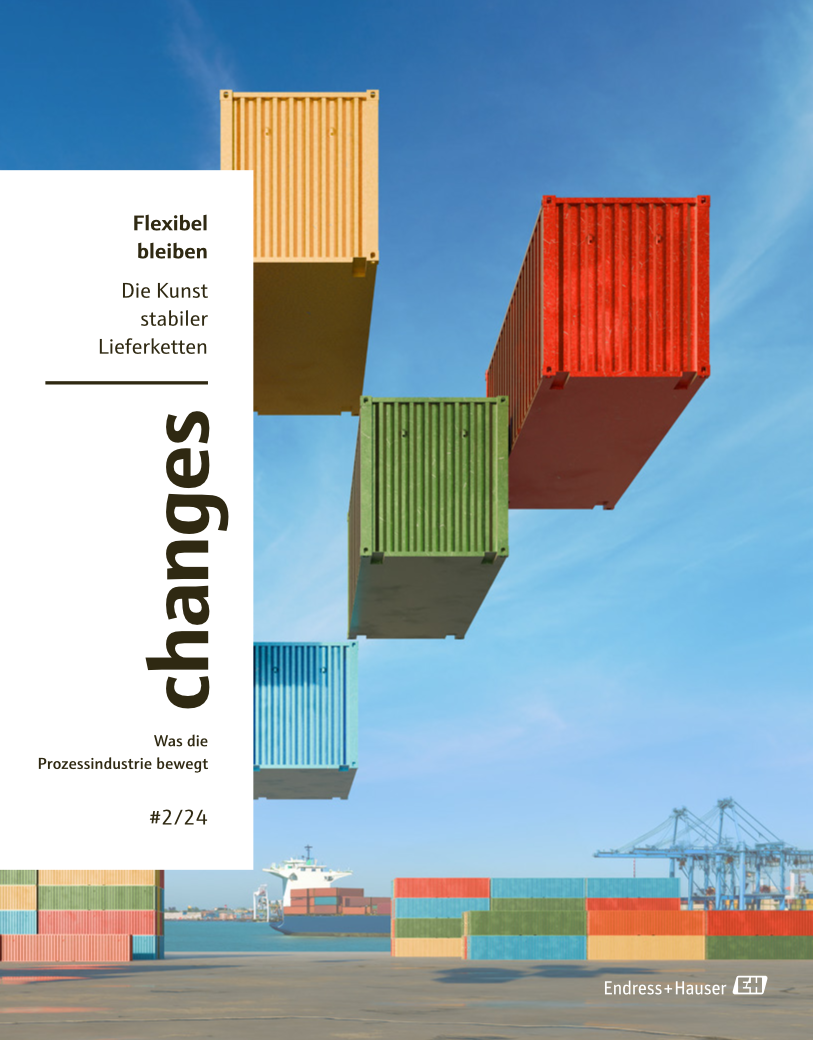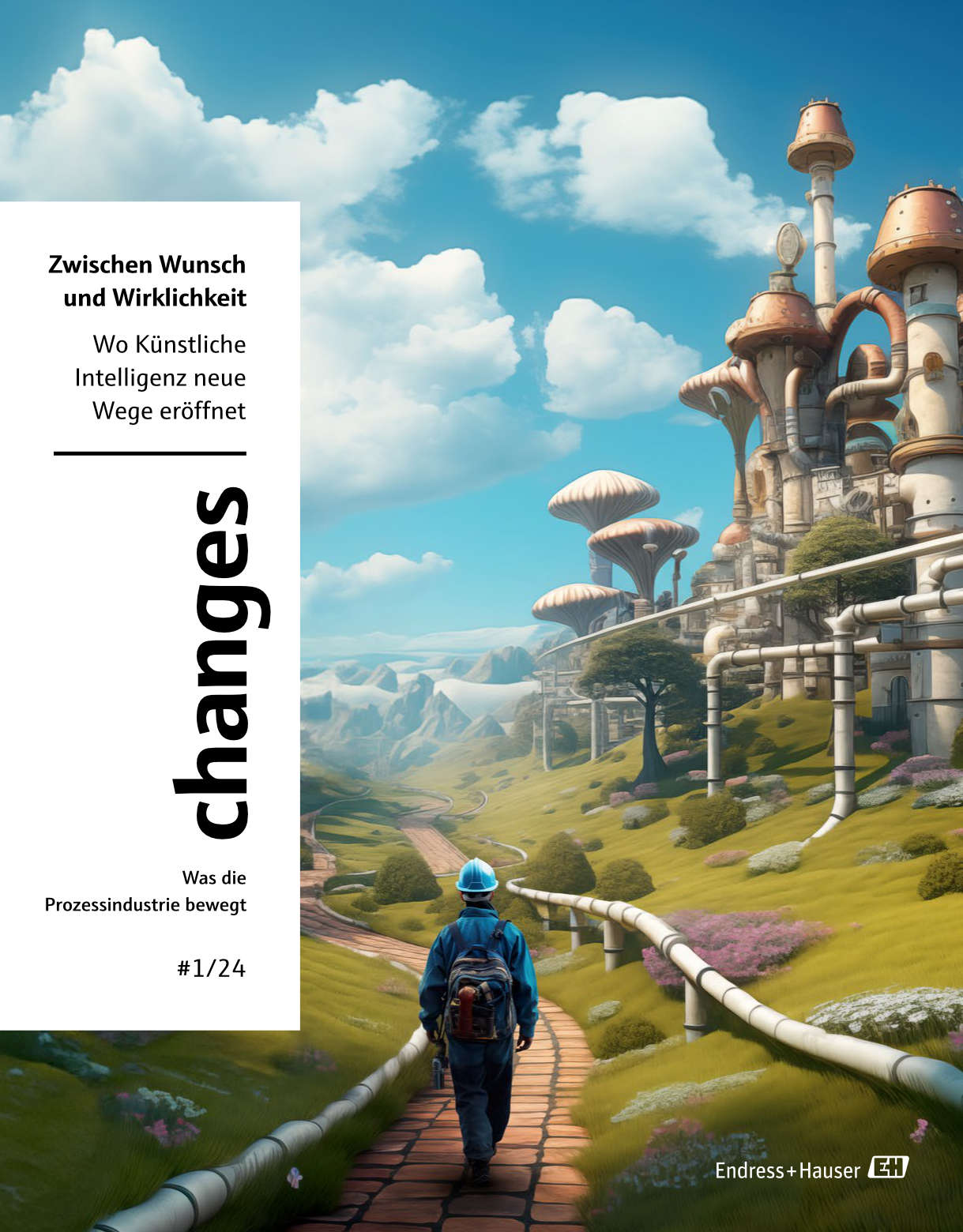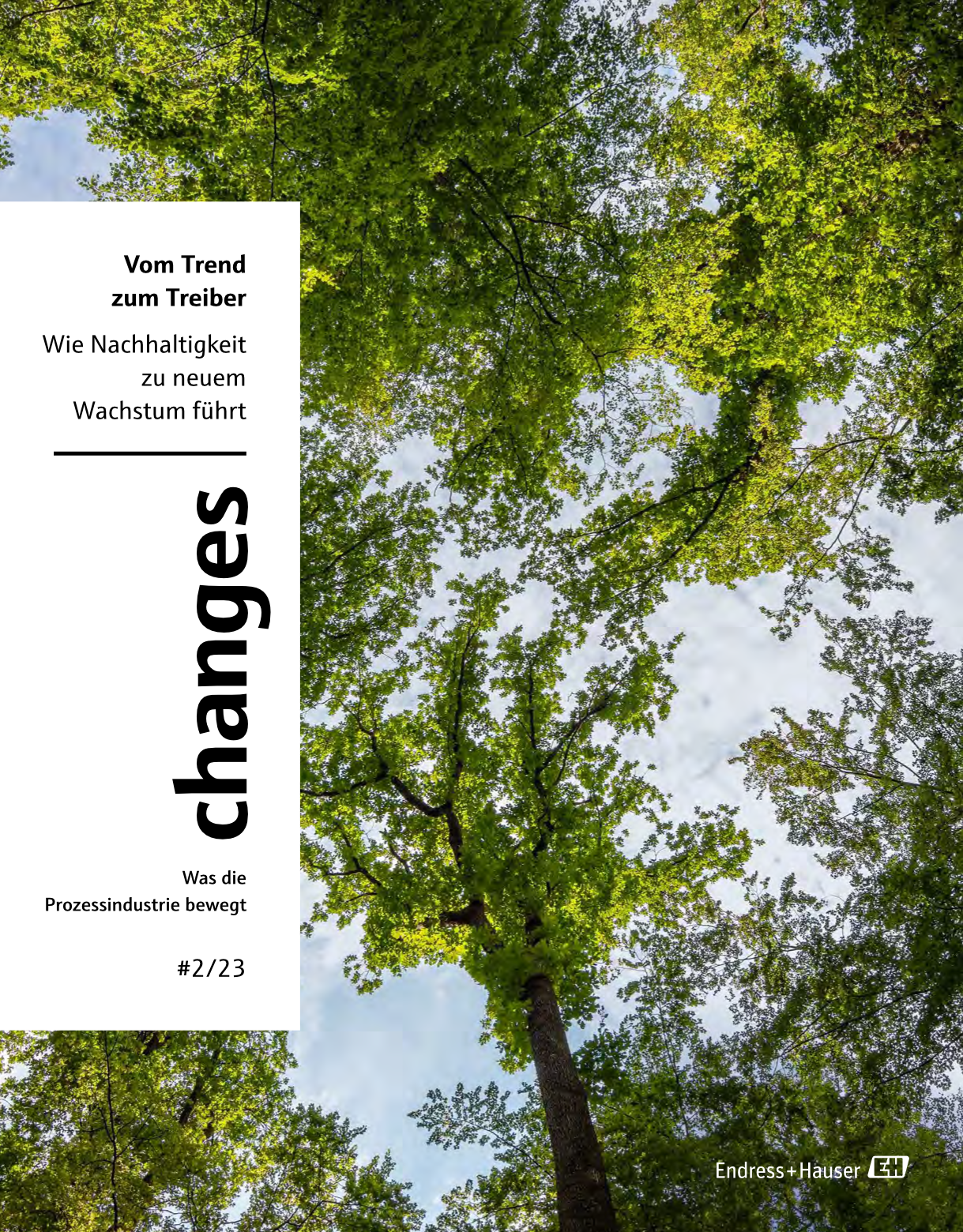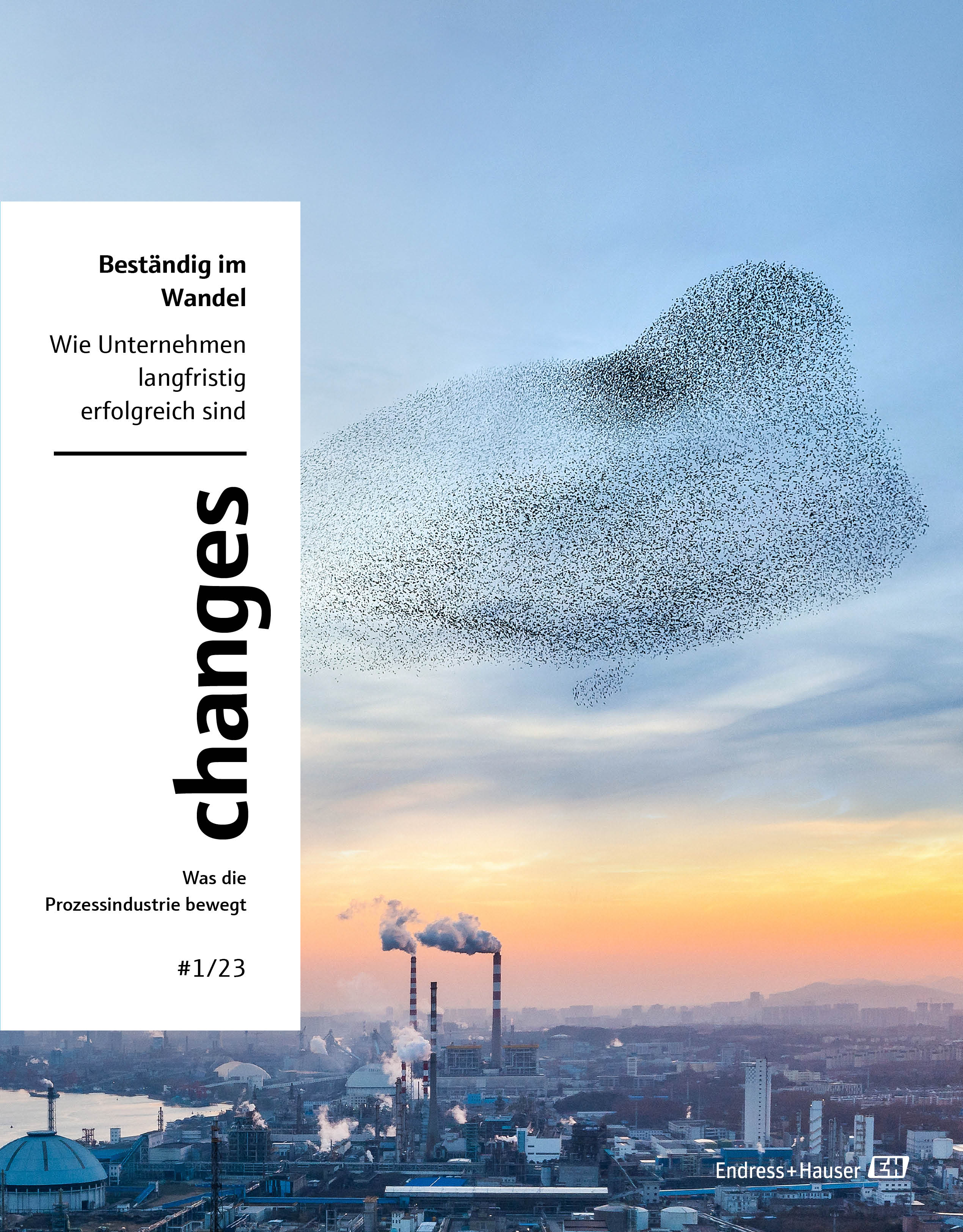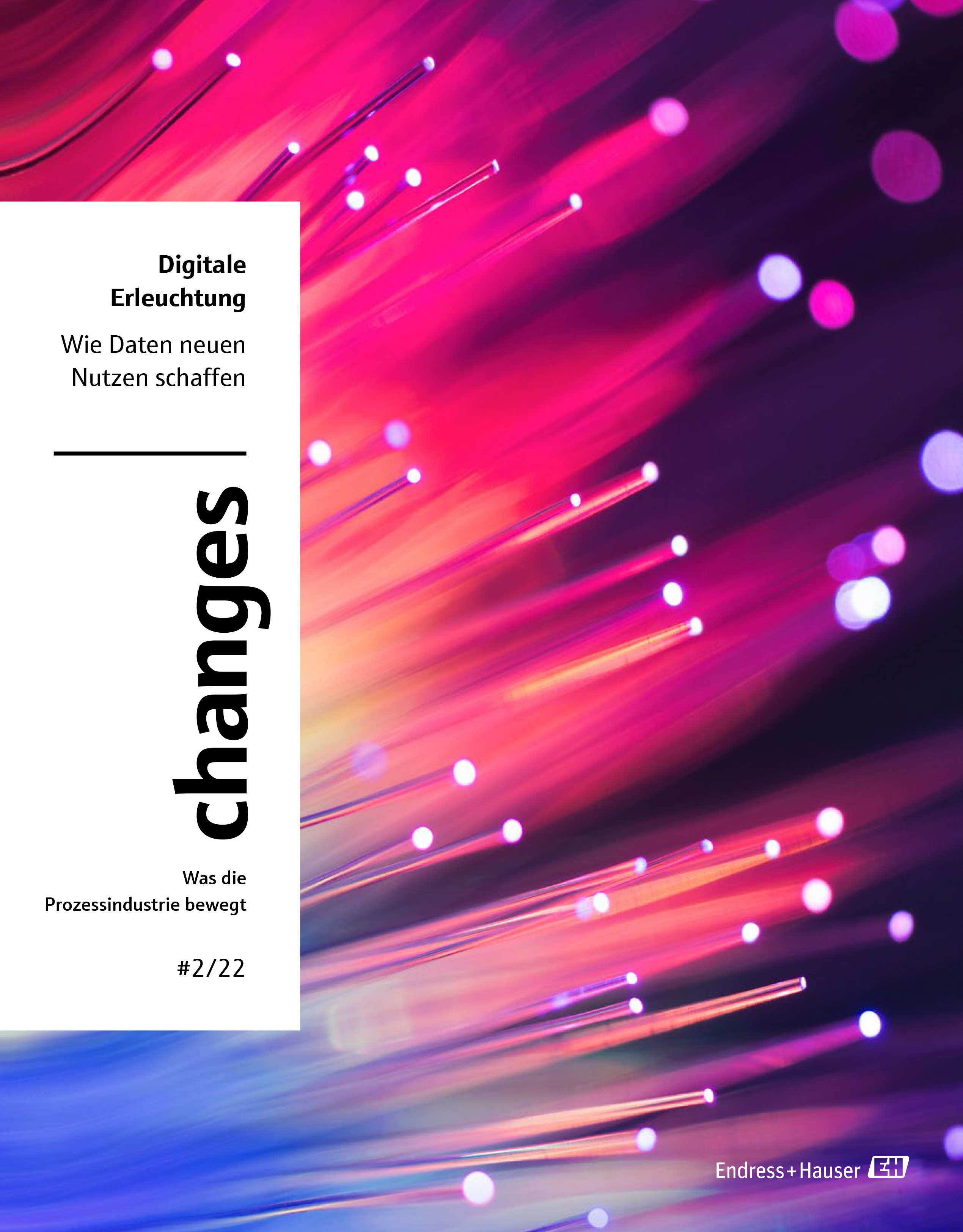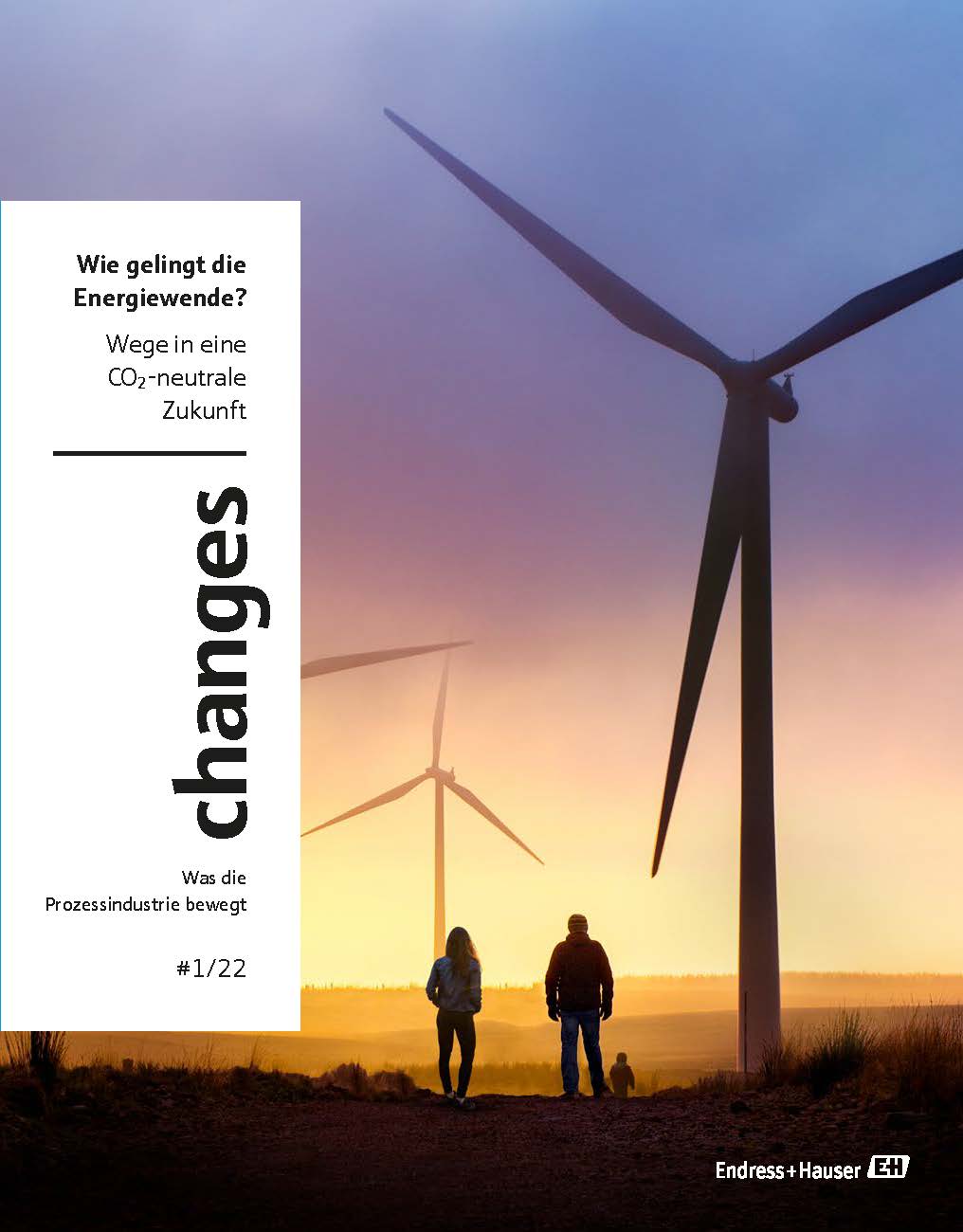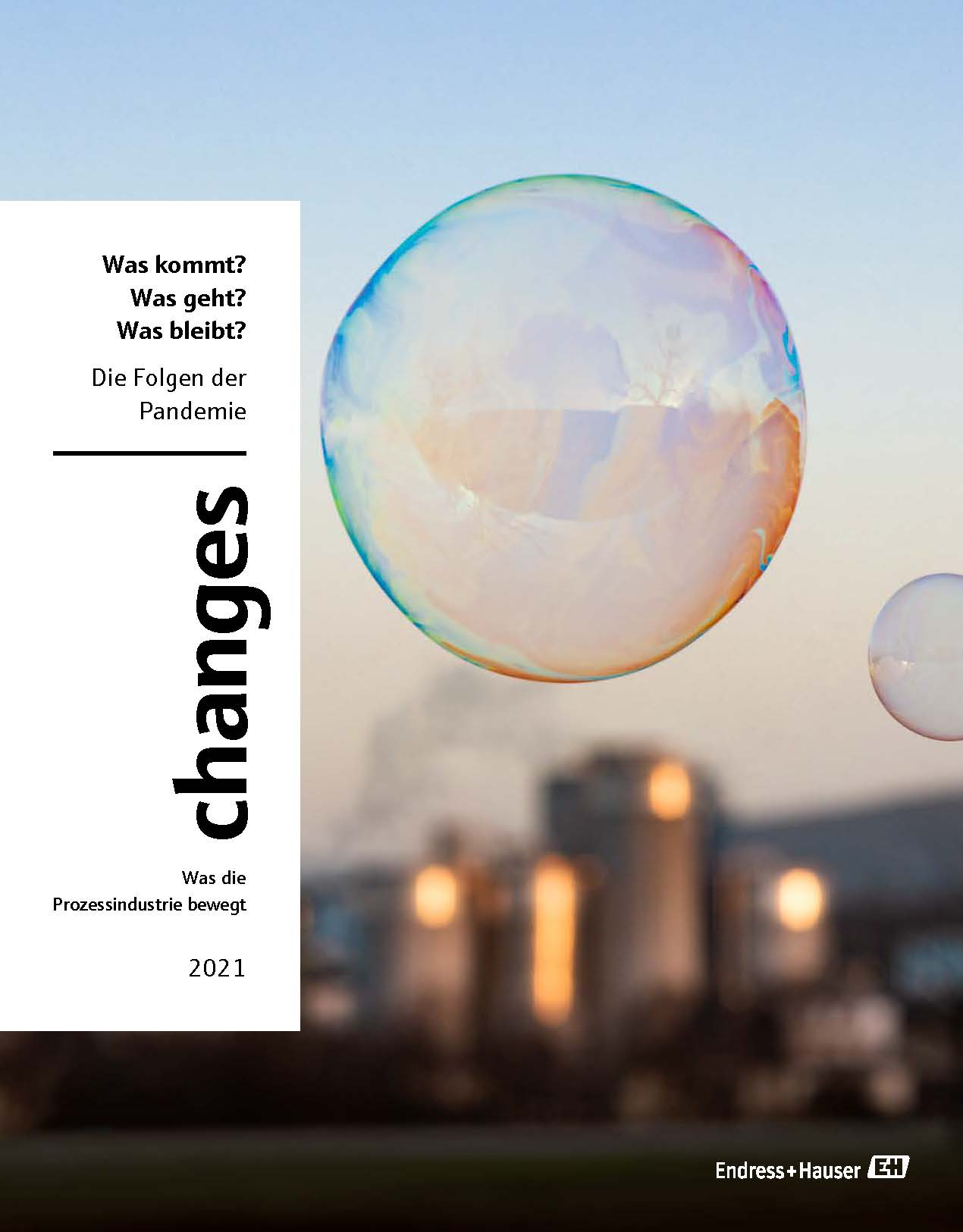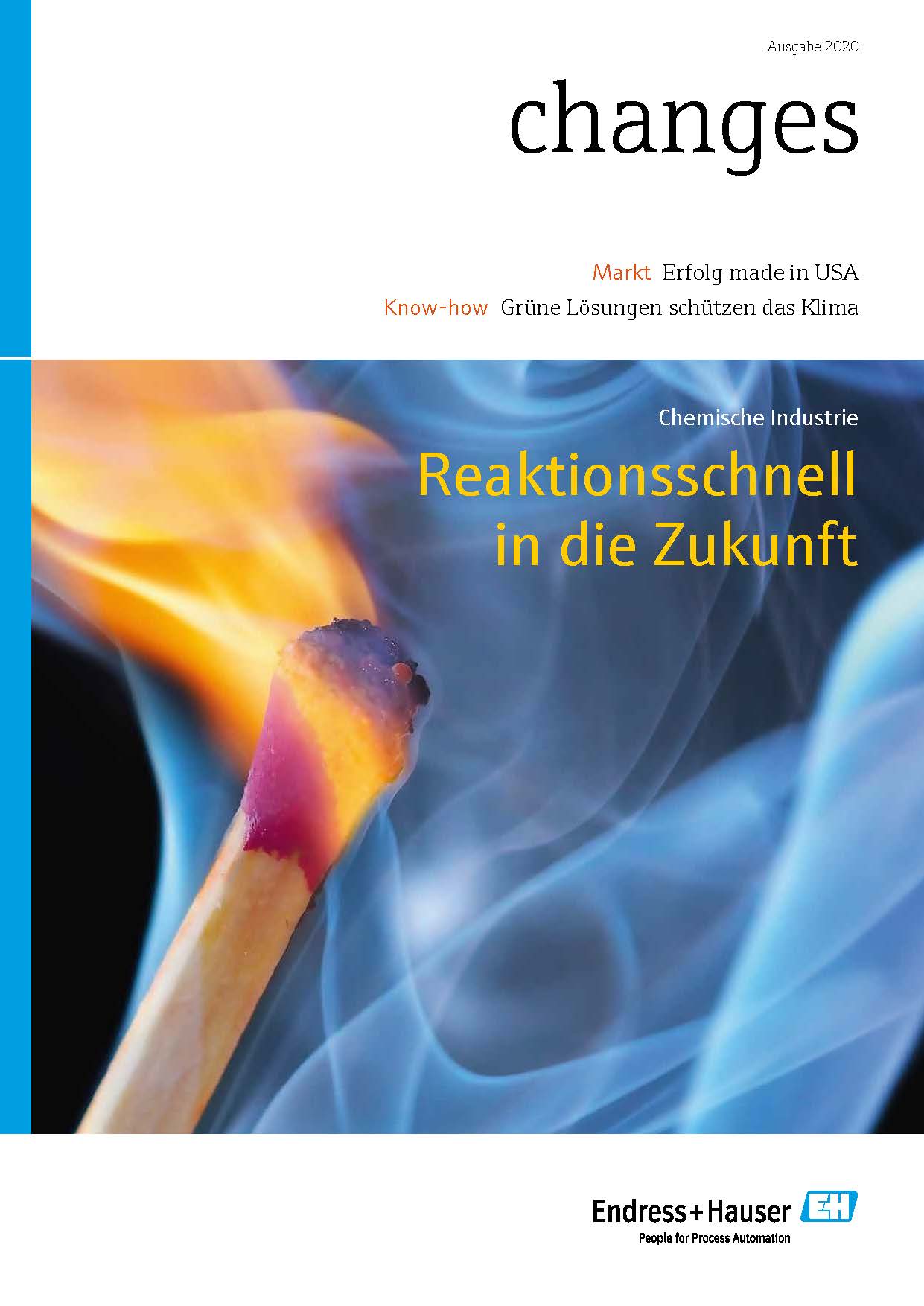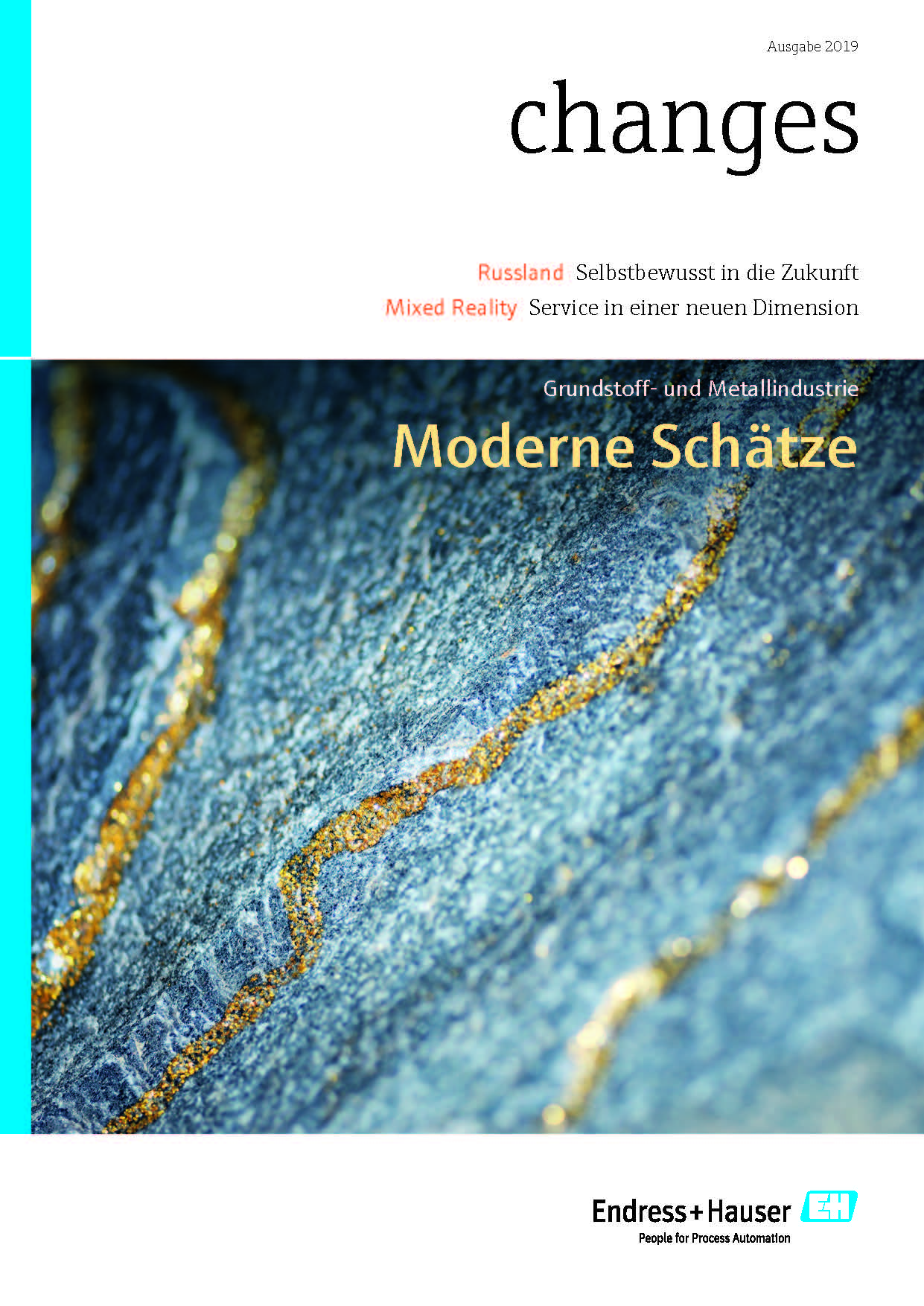Neues Denken
Nehmen, produzieren, entsorgen: Die Folgen unserer Wegwerfwirtschaft treten immer deutlicher zutage. Umdenken ist angesagt. Doch noch fehlt der Kreislaufwirtschaft die Initialzündung.
Ein Blick unter die Motorhaube offenbart das Dilemma unserer linearen Wirtschaft: Ohne den Wegwerfartikel Zündkerze funktioniert kein Benzinmotor. Jedes Jahr werden weltweit mehr als eine Milliarde dieser Zündelemente ausgewechselt und landen auf dem Müll. Immer häufiger sind es Kerzen mit einer speziellen Iridium-Beschichtung. Das extrem temperaturbeständige Metall verbessert nicht nur die Verbrennungseffizienz, sondern verlängert auch die Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Nickel-Zündkerzen um das Dreifache.
Obwohl für jede Zündkerze nur winzige Mengen Iridium verarbeitet werden, stellt die steigende Nachfrage nach den Hightech-Kerzen ein Problem dar. Jährlich landen rund 100 Kilogramm des seltenen Metalls deshalb auf Deponien oder in Schrottschmelzen. Da auf der ganzen Welt nur ungefähr acht Tonnen Iridium pro Jahr gefördert werden, wird es immer schwieriger, den steigenden Bedarf zu decken, der durch die Energiewende zusätzlich angeheizt wird. Denn Iridium ist auch ein entscheidender Katalysator bei der Herstellung von Wasserstoff durch die PEM-Elektrolyse.
Bisher basiert unsere Wirtschaft auf dem Muster „Nehmen, Produzieren, Wegwerfen“. Abgesehen von wenigen Beispielen wie dem Sammeln von PET-Flaschen oder Papierabfällen sind die weltweiten Recyclingquoten bescheiden. Das liegt vor allem an der Wirtschaftlichkeit: Da Neumaterial billig ist, lohnt sich das Sammeln und Aufbereiten nicht. Doch der Preis spiegelt nicht den wahren Wert der Ressourcen wider. Das zeigt sich alljährlich am Earth Overshoot Day. Es ist der Tag, an dem alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. 2024 war dieser bereits am 1. August.
106Mrd. t
Ressourcen und damit mehr als dreimal so viel wie in den 1970er-Jahren verbraucht die Menschheit aktuell jährlich laut Global Resources Outlook 2024. Das sind pro Kopf 39 Kilogramm täglich.
VON DER COWBOY- ZUR SPACE-ÖKONOMIE
Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass die Menschheit 70 Prozent mehr Ressourcen verbraucht, als die Ökosysteme der Erde regenerieren können. Dennoch stammen nur sieben Prozent der Materialien, die heute in Produktionsprozesse einfließen, aus dem Recycling. „Cowboy-Ökonomie“ nannte dies der Ökonom Kenneth Ewart Boulding bereits 1966 und stellte dem Konzept der rücksichtslosen Ausbeutung in offenen Gesellschaften die „Raumfahrer-Ökonomie“ gegenüber: Ein geschlossenes zyklisches System, das seine Stoffe ständig reproduziert – das Konzept der Kreislaufwirtschaft war wiederentdeckt.
Dabei ist Kreislaufwirtschaft mehr als Recycling. Sie zielt darauf ab, natürliche Ressourcen auf die effizienteste Art und Weise zu nutzen – immer und immer wieder. Auch Stoff- und Energiekreisläufe werden dazu geschlossen. Erst dann, wenn keine Reparatur, keine Wiederverwendung und keine Wiederaufbereitung mehr möglich sind, wird recycelt. Weil Produkte und Stoffe auf diese Weise viel länger im Wirtschaftssystem gehalten werden, sinkt der Bedarf an Neumaterial drastisch.
In den integrierten Produktionskomplexen der chemischen Industrie sind Energie-, Wärme- und Stoffkreisläufe auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten gängige Praxis: Nebenprodukte oder Abwärme aus dem einen Prozess werden zum Rohstoff für den nächsten. Doch sobald die Endprodukte das Werk verlassen haben, ist bislang Schluss mit Kreislaufwirtschaft. Das soll sich nun ändern.
Denn klar ist: Ohne Kreislaufwirtschaft wird die gesamte Industrie weder Nachhaltigkeit noch Klimaneutralität erreichen. Das Beratungsunternehmen Roland Berger kommt zum Schluss, dass der Abbau und die Verarbeitung von Rohstoffen für 90 Prozent des Biodiversitätsverlustes und des Wassermangels sowie ein Drittel der schädlichen Gesundheitseinflüsse verantwortlich sind. Die Ellen MacArthur Foundation schätzt, dass durch Kreislaufwirtschaft rund 45 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen, die bei der Herstellung von Produkten und Materialien entstehen, eingespart werden können.
KREISLAUFWIRTSCHAFT NEU LERNEN
Doch obwohl die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft seit langem bekannt sind, tun sich Unternehmen bislang schwer, sie umzusetzen. Denn in Kreisläufen zu wirtschaften setzt voraus, ganz neu zu denken. Produkte müssen zum Beispiel kreislauffähig und auf Basis alternativer Rohstoffe entwickelt werden. „Wenn wir wirklich einen Mehrwert generieren und uns von festgefahrenen Denkmustern verabschieden sollen, die uns in einem Wirtschaftsmodell festhalten, das aus Nehmen–Herstellen–Wegwerfen besteht, dann müssen wir schon beim Entwurf darüber nachdenken, wie wir mit weniger Produkten auskommen und wie wir Produkte wiederverwenden und reparieren können“, schreibt Julia Binder, Professorin für nachhaltige Innovation und Geschäftstransformation und Co-Autorin des Buches „The Circular Business Revolution“.
Dazu kommen hohe Anfangsinvestitionen, komplexe und intransparente Lieferketten, fehlende Standards und Regulierungen für Rücknahme, Wiederverwendung oder Recycling sowie fehlende Technologien für effektives Recycling oder Wiederverwendung. Und schließlich das Henne-Ei-Problem: Die Nachfrage nach Sekundärrohstoffen ist noch gering – auch weil Primärrohstoffe wie Kunststoffgranulate oft billiger sind als Recyclingmaterial. All das bremst notwendige Investitionen in die Kreislaufwirtschaft.
Doch die Erkenntnis wächst bei den politischen Akteuren, dass Kreisläufe die Zukunft sind – auch in der Politik: In den USA ist das Sustainable Materials Management Program der Umweltbehörde EPA ein Anfang. China hat bereits 2009 ein Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft erlassen und in der Europäischen Union gibt es seit 2020 den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft.
„Wir müssen schon beim Entwurf darüber nachdenken, wie wir mit weniger Produkten auskommen und wie wir Produkte wiederverwenden und reparieren können.“
Julia Binder,
Professorin für nachhaltige Innovation und Geschäftstransformation am IMD Lausanne
ZUSAMMENARBEIT ALS SCHLÜSSEL
„Die meisten Unternehmen sind noch in der Findungsphase und beginnen gerade erst zu verstehen, was Kreislaufwirtschaft für sie und ihre Kunden bedeutet. Schnell wird dabei klar: Allein lässt sich das Problem nicht lösen, denn alles ist mit allem verbunden“, erklärt Michael Sinz, Director Strategic Business bei Endress+Hauser, die Situation. Kreislaufwirtschaft ist in seinen Augen ein komplexes System, das nur durch Kollaboration im Ökosystem-Ansatz bewältigt werden kann. „Für Unternehmen, die Innovation meist intern halten, ist dieser neue Weg gemeinsam mit Partnern deshalb oft eine Herausforderung.“
Auch Julia Binder sieht einen entscheidenden Aspekt darin, dass Unternehmen ihre Wettbewerbsmentalität hinter sich lassen und auf Zusammenarbeit setzen: „Im Gegensatz zu traditionellen linearen Geschäftsmodellen brauchen wir, wenn wir eine Kreislaufwirtschaft wollen, systemische Veränderungen. Dazu gehört nicht nur, dass wir Produktdesign und Herstellung neu denken, sondern wir müssen auch die Lieferketten, Konsumgewohnheiten und den Umgang mit Abfall neu gestalten.“
Wie es geht, zeigt das Beispiel der Kooperation des Chemiekonzerns Solvay mit dem Entsorgungs- und Recyclingspezialisten Veolia und dem Autohersteller Renault. Weil die Rückgewinnung der wertvollen Bestandteile einer Autobatterie aufgrund ihrer komplexen Zusammensetzung äußerst schwierig ist, werden die seltenen Metalle bisher nur unzureichend recycelt. Um dieses Problem zu lösen, koordiniert das Konsortium die notwendigen Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette von Batterien, um den Materialkreislauf von Elektrofahrzeugbatterien zu schließen. Der Chemieindustrie mit ihren Verfahren und Analysemethoden kommt eine Schlüsselrolle beim Recycling zu.
Was für homogene und großvolumige Produkte möglich ist, stellt weit diversifizierte Produzenten vor Herausforderungen: Wie kommen die Produkte nach der Nutzung zurück zum Hersteller? An dieser Frage scheitern bislang viele Kreislaufkonzepte. Die Antwort darauf könnten „As a Service“-Geschäftsmodelle liefern, wie sie die Softwarebranche schon lange praktiziert. Auch chemische Produkte lassen sich damit im Kreislauf halten: Die schwedische Umwelt-Servicegruppe Ragn-Sells will künftig Chemikalien wie Eisen(III)-chlorid – ein wichtiges Fällungsmittel in der Abwasseraufbereitung – nicht nur bereitstellen, sondern nach Gebrauch aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen und wiederverwenden.
> 60%
der Treibhausgasemissionen gehen auf die Verarbeitung und Gewinnung von Ressourcen zurück, hat das UN-Umweltprogramm errechnet.
NEUE CHANCEN DURCH KREISLAUFWIRTSCHAFT
Die Beispiele machen deutlich, dass Kreislaufwirtschaft große Chancen bietet. Das Beratungsunternehmens Accenture schätzte schon vor knapp zehn Jahren, dass Kreislaufwirtschaft bis 2030 eine zusätzliche Wertschöpfung von 4,5 Billionen US-Dollar generieren kann. Und noch ein weiterer Aspekt motiviert immer mehr Wirtschaftsakteure, in Kreisläufen zu denken, denn sie machen die eigenen Lieferketten widerstandsfähiger. Material, das man in eigenen Prozessen oder mit Partnern recycelt, muss nicht auf dem Weltmarkt eingekauft werden. Dieser Gedanke hat auch die aktuelle Gesetzgebung der Europäischen Union beeinflusst: Er findet sich sowohl im Critical Raw Materials Act als auch in der neuen EU-Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR).
Neben der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und der Umsetzung politischer Vorgaben für die Kreislaufwirtschaft spielt auch die Technik eine Rolle – allen voran die Digitalisierung. Experten sind sich einig: Für den Wandel hin zu einer zirkulären Wertschöpfung braucht es ein stärker datengetriebenes Recycling, eine effizientere und flexiblere Automatisierung von Demontageprozessen oder den verstärkten Einsatz von Prognosemodellen wie digitalen Zwillingen in der Produktion. Damit dies möglich wird, verpflichtet die Europäische Kommission Unternehmen im Rahmen der neuen ESPR-Verordnung, ihren Produkten ab 2026 einen digitalen Produktpass beizulegen, der umfassende Informationen zu Lebensdauer und ökologischem Fußabdruck enthält.
„Allein lässt sich Kreislaufwirtschaft nicht realisieren – alles ist mit allem verbunden.“
Michael Sinz,
Director Strategic Business bei Endress+Hauser
ANREIZE BRINGEN DEN KREISLAUF IN SCHWUNG
Angesichts wachsender Ressourcenengpässe und des Klimawandels drängt die Zeit. Für Ellen MacArthur, Gründerin der gleichnamigen Stiftung, ist der Umbau der linearen zu einer Kreislaufwirtschaft daher alternativlos: „Das Leben selbst existiert seit Milliarden von Jahren und ist per Definition zyklisch. Wir haben dieses System seit der Industriellen Revolution durchbrochen. Unser Nehmen-Herstellen-Wegwerfen-System, in dem wir Umweltverschmutzung erzeugen, Materialien verschwenden und eine wachsende Weltbevölkerung in einer linearen Wirtschaft unterstützen, ist langfristig nicht tragfähig“, sagte Ellen MacArthur am Rande der Weltklimakonferenz 2023.
Entscheidend wird neben Druck und Knappheit jedoch die Aussicht auf gute Geschäfte sein – im Fall der Iridium-Zündkerzen vielleicht die Erkenntnis, dass gezieltes Sammeln und Verwerten klüger ist, als sich in Abhängigkeiten zu begeben.
Der Autor Armin Scheuermann ist Chemieingenieur und Fachjournalist.
5.4Mrd. $
wurden 2022 weltweit in Start-ups für die Kreislaufwirtschaft investiert. Das ergab eine Analyse des führenden europäischen Gründungszentrums UnternehmerTUM.
Veröffentlicht am 25.04.2025, zuletzt aktualisiert am 08.07.2025.
Tauchen Sie mit dem Newsletter von «changes» jeden Monat durch neue spannende Geschichten in die Welt der Prozessindustrie ein!